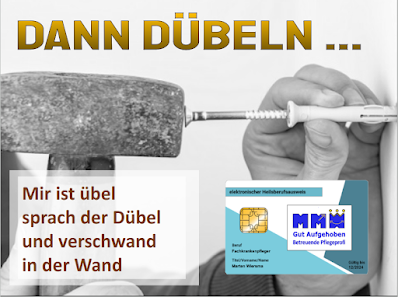Inhalt
Informationen zur Businessplan
2. Soziales Thema
3. Ansatz der Initiative
4. Team
5. Finanzplan
Vorbemerkungen zum Mikromezzanine Konstrukt des Finanzplans
Ausgaben
Finanzielle Situation
6. Ausblick und Beratungsbedarf
7. Formale Angaben
Organisationsform und -stand
Informationen zur Businessplan
1. Kurzporträt der Initiative
Initiative für Quartierpflege
Die Initiative für Quartierpflege macht sich zur Aufgabe, für selbständige Nutzer pflegesensiblen Service in Hotelqualität mit “Click & Brick” zu vernetzen.
Die Initiative verwirklicht das online vermittelte “Hotel at Home” [H@H] durch betreuende Pflegeprofis offline, zugelassen n. § 124 SGB V. Die hybride Aufstellung erlaubt vernetzte Arrangements und passgenaue Mixe von professioneller und ehrenamtlicher Hilfe. Mit dem Ziel, Prosumenten zu befähigen (Probability Approach), seinen vulnerablen Alltag zu meistern.
Die Initiative präsentiert H@H-Service nach Wunsch gem. § 71 (1a) SGB XI. Budgetnutzer können spontan gem. TSVG pflegesensible Service bei intrasituative Ereignisse beauftragen & terminieren. Hilflosigkeit, Isolation und Überforderung sind so vermeidbar. Das Projekt soll auch Notfalleinsätze und (temporäre) stationäre Verhinderungspflege tunlichst reduzieren.
Exklusive Gutscheinpflege. Für Budgetnutzer n. § 35a SGB XI der sein Bedarf selbst navigiert. Finanziert mit einem Pflege-Tickett durch die Pflegekasse. Die Freiheit, wie er seinen Servicebedarf terminiert, um sich auf neue Alltagssituationen einzustellen, bleibt ihm alleine, uneingeschränkt, vorbehalten hinsichtlich Quantität und Qualität.
Aktionsfeld Mikroraum. Der pflegerische Sozialraum ist der häusliche Wohnraum. Hier wird sowohl [1] ein temporärer Behandlungskonzept nach Entlassung aus Klinik als „Hilfe zur Selbsthilfe“ angeboten [H@H-Deloitte], wie auch [2] für Langzeitpflege mit Bedarf an Sicherheit, Förderung der eigene Ressourcen und Betreuungskomfort.
Wirkungsort: Die Initiative ist in und um die Region Oberhausen Zentrum aktiv.
Quartiernähe hat den Vorteil, eine schnellere Verfügbarkeit von pflegefachlichen Einschätzungen zu garantieren und zu verquicken (H@H). Verknüpft mit bezahlbaren Angebote von spezialisierten Sachverstand, die durch den Wegfall von Wegstrecken die Versorgungsstruktur begünstigt. Der Beschränkung auf den Quartiers-Sektor ist der Changemaker. Der zum Kerngebiet zuzurechnende Bereich Fortbildung, Forschung und Entwicklung soll Zukunftstechnologien für die Pflege nutzbar machen
Fernziel: Pflegesensitive Betreuungsservice nutzt seit 2007 das Modell des Discounters. Pflegepräsenz konzentriert pflegesensible Service auf das Wesentliche. Progredient weiterentwickelt n. der 3. Gossensche Gesetz. Um den autonomen Bedarfnutzer instantan zu vernetzen. Online mit modernster Technik (H@H per Click) wie auch offline mit frei verfügbaren Pflegeprofis (Care-Craftsman per Brick).
Co-Faktor Telepflege [optionale Zusatzleistung] um sowohl die Jobzufriedenheit bei professionell Pflegenden zu erhöhen sowie dazu beitragen, dass Budgetnutzer ihre Gesundheitskompetenz und Zufriedenheit effizienter gestalten können.
Gesundheit / Pflege / Betreuungsbedarf
Inklusion / Teilhabe
Leben im Alter / Intergeneration / Einsamkeit (soziale Isolation)
Migration / Integration
Nachbarschaft / Zusammenleben
Altersarmut / soziale Gerechtigkeit
Familienunterstützung
Rettungsdienst / Notfallversorgung
Tod / Trauer
Medipflege - betreuende Pflegeservice
Sanderstr. 15
46045 Oberhausen
2. Soziales Thema
Die Initiative bezweckt Care im Quartier aufzuwerten. Als hybrides Projekt. Entweder aktiviert der Nutzer einen 24/7 zugängliches virtueller Broker über ein Online-Portal. Oder er wendet sich zu den Geschäftszeiten an einer der sechs v/d Stadt unterhaltene Quartierbüros. Beide Wege eröffnen ihm Zutritt zu einer Service und Terminierungsschnittstelle die geeignet ist seine individuelle Q-Versorgung mit sein Pflegebudget im petto selbst zu navigieren.
Digital werden ihm ALLE frei verfügbare, selbständige Pflegepersonen in Echtzeit angezeigt mit weitere, verfügbaren Terminoptionen. So kann Pflege auf Abruf spontan erfolgen, so einfach wie ein freies Zimmer über Airbnb gebucht werden kann. Das Besondere: die Abrechnung erfolgt ausschließlich aufgrund eines Pflege-Tickets. Ausgestellt als Gutschein durch den Kostenträger zur freien Verfügung für den Inhaber.
Wie viele Menschen sind betroffen?
5% i/d Schweiz (Deloitte) und in Oberhausen: “Aufgrund des seit dem 01.01.2017 geltenden neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sind in OB nur ausreichende Datenreihen vorhanden … Die Anzahl der Pflegebedürftigen ist seit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes um ca. 24 % gestiegen.” Die neuesten Zahlen (03.04.2023) zur Pflegebedürftigkeit in OB (15.954 Bürger) bestätigen Hr. Kegelmanns Tendenzprognose 2022: 7,5,9%. Lt.Vorjahrsbericht betrug die Zielgruppe nur ca. 5 % bei 210.000 Einwohner: Ohne amb. Pflegedienst: wurden 11.031 Personen außerhalb der Profi-Sektor pflegesensibel versorgt. Bezüglich der Regio OB Dümpten (8.000 Einw.) besteht die > 5 % Zielgruppe aus ca. 400 Bürger. Die verfolgte Click- & Brick-Strategie sieht ihre Daseinsberechtigung darin, 1 % dieses Klientel (± 4 Leute) zu unterstützen um den seit 2019 geltende Norm zur Verbesserung der Pflegeservice beim Bürger 24/7 zu optimieren mittels eines Pflegebudgets, damit Nutzer besser in die Lage versetzt werden, sein AUA-Bedarf in denkbar einfachster Form zu terminieren. Dafür ist das TSVG geschaffen - wenngleich nur selten angewandt. Das möchte diese Initiative ändern.
Warum sich der Initiator diesem Thema widmet.
Storytelling: Als Gründungsmitglied der “Fachgruppe Diakonie” in der kirchl. Gewerkschaft VKM war der Initiator 2007 der 1. freiberuflich aufgestellte Fachkrankenpfleger vor Ort. Außerhalb einer spannungsgeladenen Hierarchie erlebte der Initiator, wie mikroökonomische Pflegepräsenz sich erfolgreich selbständig positionieren konnte.
Das Leitmotiv resultiert aus Erlebtem: Was deutschlandweit als Honorartätigkeit hochprofitabel war, um Pflegenotstand effektiv zu begegnen, lässt sich pragmatisch auch im Quartier mobilisieren. Mit der Leitmaxime, dass ein erfolgreicher Engagement nur dann zeitnah eine bessere Quartiersversorgung realisieren kann, wenn der Verbraucher von Bedarfe selbst in der Lage versetzt wird, effektiv und effizient die Angebote verfügbare Pflege eigenständig anzusteuern, auszuhandeln, zu qualifizieren - und ggf. abzulehnen.
Die Autonomie eines Budgetnutzers ist die kardinale Voraussetzung. Formal ist die Zulassung n. § 124 SGB V als Verwaltungsakt deklaratorisch rechtsverbindlich (Fr. Kallenberg). Plus 24/7 zugängliche, belastbare Daten: wer, wann, wo und wie teuer lassen sich Pflegeprofis buchen?
Re:Booten gilt hier als schöner Nebeneffekt: Die Initiative vermag schlummernde Ressourcen an Manpower i.S. re:entry zu reaktivieren als moderne Care-Craftsman: Jene ins Abseits gedrängte Pool an zugelassene und qualifizierte Pflege- und Betreuungsfachkräfte.
3. Ansatz der Initiative
Der Ansatzpunkt bei der Initiative
Instantane Versorgung bedeutet: sofort, sooft pflegerische Ereignisse situativ eintreten, zu “unpässlichen” Ereignissen ein passendes, individuelles Gesicht zu vermitteln. So, mit Geschwindigkeit, verleiht die hier verfolgte Initiative die Pflege “auf die Schnelle” Pflege ein ganz neues Gesicht: Direkt 1:1 vermarktete Pflege. Durch online vermittelte, passgenau auf echte Bedürfnisse abgestimmte Handwerkerservice. Das unterscheidet die Initiative von naturgemäß träge agierenden makroökonomische Anbieter. Vorgelegte Pflegeverträge mit Konditionierungszwang sind zu signieren, bevor man mit der ersten Handgriff beginnt. Mit bekanntem Überraschungsfaktor: Wer steht als abkommandierte Servicekraft vor der Tür? Darüber entscheidet in klassischer Weise immer der Anbieter, statt der Pflegebedürftigen.
Vorteil dieser Ansatz im Vergleich
Beim mikroökonomisch auftretenden Budget-Teilnehmer ist einfach Vieles einfach anders: DUAL. Niemand grätscht zwischen zugelassenen Anbieter und selbstständig auftretenden Budget-Teilnehmern. Nicht so einfach ist es bei der klassischen makroökonomischen Versorgung, abseits des Pflegebudgets. Die Kostenträger funken als Institution immer als DRITTE zwischen der Struktur “Patient & Pflegekraft.” Normativ vorgeschaltete Kostenträger kontrollieren und reglementieren Büro- und Abrechnungs-Angelegenheiten mit einer Unzahl an Vorgaben n.d. SGB. Für Menschen mit geringem Einkommen ist “Gerechtes Sorgen” bequem. Dieses im Hintergrund verborgene Vorgehen (Marlies Ahlert), holt für ihn “Das Beste” heraus. Leider neigen makroökonomische Steuerungsprozesse dazu, weil primär an finanzierte Transaktionen gekoppelt, zu verhängnisvoller Fehlsteuerung mit explodierende Reglementierungswut plus Kosten. Normale Verbraucher erleben intransparente Kosten; diese zu ignorieren bleibt ihm jedoch selten völlig erspart. Z.B. bei Posten wie Hotellerie und Investitionskosten. Viel Geld, das Pflege keinen echten Mehrwert gibt. Vielmehr generiert es fragwürdige Komfortsteigerung bei Heimpflege: Wohnmaschinen als Verwahr-Anstalten die lebensverkürzender Immobilität in superseichte Stressless-Sessel vor-programmieren.
Diese kostenschlürfende Administration zehrt am Tropf der Finanzaufwand die der Moloch der Gesundheitsindustrie schluckt. Idealerweise erfüllt sie ihren Zweck und es gibt auch kritische Stimmen zu Pflegebudgets. Makroökonomisch dirigierte Pflegeprozesse weisen jedoch in vielen Einzelfällen schlicht zu viele parasitäre Zwischeninstanzen auf. Alle wollen voll versorgt und bezahlt werden: selbst dann, wenn de facto Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen werden. Beispielsweise Küche im Heim: in Echtzeit werden die Leistungen auch dann abgerechnet, wenn seit einer Woche nichts aus der Küche gegessen wurde.
Gelingende Pflege gelingt nur dann in vollem Umfang, wenn beide beteiligten Akteure eine win-win-Strategie verfolgen. Preisbewusste Kunden vermeiden das Bezahlen eines nutzlosen Overhead. Diese ‘Überbaukosten' werden gesenkt. Gleichzeitig werden paradoxerweise die Verdienste für Pflegeprofis gehoben. Dadurch hervorgerufen, wenn Nutzer von Pflegebedarf mit 1 Click Manpower auf ein Blick in Echtzeit kartographiert vorfindet: direkt vermarktete, einfache und preiswerte, passende Angebote die ihm den Wahl lassen, WER als zugelassene Person ihm jeweils zu WELCHE Preis WANN und WIE seine Versorgung sicherstellen soll.
Am 19. Oktober 2017 wurde in Oberhausen auf dem 3. Sterkrader Symposium zum Thema “Diversitätsmanagement – Vielfalt im Quartier” festgehalten, dass es in Deutschland (und OB) eine zunehmend multidimensionale Quartiersdefinitionen gibt. Gekennzeichnet mit unterschiedlichen Versuchen, mehrere Komponenten miteinander zu verbinden - häufig nur eine unzureichende Abgrenzung.
Verbesserungen wären ggf. zu erwarten von modellierten „City Villages“, die insbesondere für die ältere Generation (mit eingeschränkter Mobilität) von Interesse wären. Dabei läge dann der Tenor auf einer Q-Ebene mit Rahmenbedingungen, die eine Basis schaffen für nachhaltige soziale und ökonomische Entwicklungsprozesse.
Der Crux dabei: diese Q-Konzepte sind makroökonomisch gedacht und funktionieren vor Ort nur als Mikro-Modell unter dem Etikett “Betreutes Wohnen”. Abgespeckt als Geschäftsmodell in Seniorenheim-Light-Format werden City-Village-Konzepte vom Ansatz her dem Konsument von Bedarfe als miniaturisierten City-Village-Modell “übergestülpt”.
Mit ein riesiges Regelwerk an Versorgungs- und Vertragstrukturen. Anbieter vermarkten mit gleicher Zuschnitt in gleicher Weise auch Senioren- oder Demenz-WG’s. Umworben als optimale Komfortzone, mit erprobte und gelobte Versorgung durch Assistenzkräften. Das sind Betreuungskräften, die rundum-die-Uhr aufpassen. Pflegevorbehaltsaufgaben und bei “Notfälle” vermitteln sie extern angeforderte Gebrechlichkeitskompensationskompetenz. Bei genauere Betrachtung (WAZ) entpuppen diese Geschäftsmodelle sich als extrem teure Altersheim-Light-Versionen, jährlich rund € 70.000 p.a., sodass fast zwangsläufig bei dieser Wohnform rund ⅓ aller Rentenbezieher Leistungen der Sozialhilfeträger in Anspruch nehmen müssen. Top-Verdienste der Betreiber von Senioren-WGs, die pro Person mtl. ± € 5.800 für sein 16 qm. Zimmer in Rechnung stellen.
Fachleute des Regionalverband Ruhr, wie der Kölner Altersforscher Prof. Frank Schulz-Nieswandt forderten am 31. Mai 2022 angesichts des demographischen Wandels auf der 4. Sozialkonferenz Ruhr mehr Vielfalt und Fantasie bei Wohnformen für Ältere und Pflegebedürftige. Schulz-Nieswandt kritisierte das derzeit vorherrschende Angebot an altersgerechtem Wohnen provozierend als „primitiv“. Pflegebedürftige Menschen hätten nur die Auswahl zwischen einer Betreuung in privaten Wohnungen oder einer „Kasernierung in Sonderwohnwelten für das hohe Alter“, also Pflegeheimen. „Wir müssen hybride. Wohnformen vorantreiben und dafür Geld investieren“, so der Soziologe. Die hier verfolgte Initiative ist nur die logische Konsequenz eines latenten Problems der Daseinsversorgung.
Den modernen Sozialfigur eines pflegerischen Subjekts, des proaktiven Prosumenten, mit einem ihm eigenen, handlungsfähigen Pflegebudget n. § 35a SGB XI kennt man nicht wirklich; die meisten Senioren-WG-Konzepten sind von Pflegefirmen konzipiert. Hier nutzen Anbieter i .S .d. vorherrschende Gesundheitspolitik. Diese“kalte” (versteckte) Pflegebudgets sind zusammengelegte bzw. “gepoolte Leistungen,” die ohne echte (WG-) Mitbestimmung der Betroffenen zur Anwendung kommen. Top-Down in Makro - statt Bottom-Up in Mikro.
Bisher erreichte Ziele
Nach Vorarbeit zur Epistemologie freiberuflicher Pflegepräsenz wurde das Q-Konzept im Rahmen einer Projekt Bramme 2020 vorgestellt. Online-Einbindung von pflegesensible Betreuungspräsenz im Angebotsfinder.NRW.de mit dem Ziel, mikroökonomisch finanzierte, nutzergesteuerte Q-Pflege auf digitaler Basis [Click], unterstützt von Q-Büros mit Beratungs- und Brokerfunktion anhand eines persönliches Pflegebudget auch für Menschen mit geringerem Einkommen bzw. niedrige Rentenbezug erschwinglich zu gestalten - quasi als modifizierte City-Village-Konzept anhand von Mikro-Logiken im Mikro-Raum zuhause.
4. Team
Anzahl Mitwirkender
Anzahl Hauptamtlicher:
Aktuell: 1 - Der Initiator, selbständige Pflegefachkraft (bezieht Altersrente).
Anzahl freier Honorarkräfte betr. OB; online gelistet auf Angebotsfinder.nrw.de
Anzahl: > 9 Personen - (Gig-Economy)
Aufstellungsmerkmale des Teams
Die Initiative ist hybride aufgestellt. [1] Online (als Click-Angebot) wird pflegesensible Betreuungspräsenz 24/7 über das Portal Angebotsfinder uneingeschränkt angeboten. [2] Präsenz-Service [Brick-Angebote] abrufen, beauftragen und Einsätze sowohl aushandeln wie auch nach Bedarf terminieren, kann ausschließlich der Nutzer.
Besonderheit des Teams.
Angebotene Click & Brick Arrangements im Zuge einer Gig-Economy weisen einen riesigen Vorteil auf: unabhängig zu sein vom eng gesteckten Tourenplan und dem Personalbestand eines Anbieters. Dessen Schattenseite: Einsätze kommen nicht “automatisch” angetourt. Jeder Einsatz darf der Budgetnutzer individuell aushandeln und disponieren - aber er muss es auch Oder, abwägend, auf [eher belanglose, unnötige] Einsätze verzichten.
Es liegt in der Hand des Teilnehmer eines pers. Pflegebudgets rechtzeitig zu den gewünschten Termin “seine” Service zu engagieren. Bei den aktuell sehr eingeschränkten Online gestellten Angebote an betreuende Pflegeprofis kann spontane Inanspruchnahme von frei verfügbaren AUA-Angebote zu Problemkonstellationen führen. Auch werden Koopkonkurrenz-Spielregel sich im Akteurs-Kollektiv eher nicht automatisch einstellen und bedürfen diese ein gepflegtes, achtsames einüben, sollte Changemanagement auch zu wirklichen Verbesserungen führen.
ist im Bereich der Dementia-Care von eminenter Bedeutung. Je mehr die Babyboomer sich mit den IoT-basierten digitale Assistenzsysteme vertraut machen kann eine achtsame Betreuung und Begleitung auch über Telepflege [AAL] dazu verhelfen eine gute Versorgung bei dysfunktionalen Alltagsstrukturen zu schaffen. Informelle, pflegesensible, überwachende und unterstützende Tätigkeiten zu mobilisieren gehört eine wesentliche, entlastende Hilfe, die die Versorgung verbessert, ggf. gekoppelt mit dem Entlastungsbetrag von mtl. € 125. Die Kausalkette beginnt am point of care, dort wo Unterstützungsbedarf anfällt. Sie kann wie der Hunger in eigener Küche begonnen werden in Selbstarbeit [selfcare] "gebastelt" [Bricolage] und ergänzt werden durch Kümmerer [Brick] die über Online-Portale [Click] gesucht und gebucht werden. Q-Büros können flankierend Broker- und Beratungsleistungen beisteuern.
Forciertes Weiterentwicklung eines selbständiges Akteurs-Kollektiv
Teilnehmer von Arbeits-Gelegen-Heiten (AGH-Kräfte) nach § 16d SGB II sind seit 2020 als frei verfügbare Präsenzkräfte in Quartierbüros installiert. Finanziert v/d AfA mit dem Zweck, LZ-Arbeitssuchende neue Perspektiven zu bieten auf der primäre Arbeitsmarkt. Diese Personenkreis umfasste 2020 satte 114 Personen und dem Sektor “ehrenamtlich” de facto gleichgestellt. Wird hier geschult mit kostengünstige (Bildungsgutschein) Bildungsangebote des Regionalbüro “Alter, Pflege, Demenz.nrw.de” liegen hier Optionen brach, Betreuungskompetenz in Zusammenarbeit mit Q-Büros zu pushen. “Der Tod des Hausmeisters" (FAZ) ist die Geburtsstunde des Betreuers.
5. Finanzplan
Vorbemerkungen zum Mikromezzanine Konstrukt des Finanzplans
Die mikroökonomische Grundannahmen [Gossensche Gesetze]
1. Gossensche Gesetz
Betreuende Pflegeprofis in Q-Versorgung sind davon überzeugt, dass mehr Geld für Pflege niemals eine notwendig bessere Q-Versorgungsqualität aufweist; im Gegenteil.
2. Gossensche Gesetz
Die Mikromezzanine steht darum als Idee im Vordergrund weil es für bedarfspflichtige Bürger lohnt dieses Finanzierungsmodell in zu nutzen. Hier erhält der Budgetnutzer auf Antrag vom Kostenträger n. § 35a SGB XI sein “Kapital” zur Investition (“Genuß” in Gossens Terminologie) in eigene Gesundheit zur Verfügung gestellt. Der “Zins-Ertrag” besteht in dem “Genußrecht,” autonom nach Gusto das angestrebte Ziel, seine Gesundung temporär per Mezzanine zu erreichen. Oder, bei Alter und Demenz, eine Steigerung einer hochwertigen Lebensqualität nach individueller Geschmack - bei gleichen Preisen ohne Kostenexplosionen.
3. Gossensche Gesetz
Immer auf Verbesserungen angelegt, gem. professioneller Bedarfsanalyse mit konviviale Evidenziteration in spe. Alle anfallenden Honorartätigkeiten werden ad hoc als Uno-Actu-Leistungen mit den Kunden verrechnet gem. Online-Preisliste.
Mit der Faustformel: 4 Menschen mit Pflegegrad 2, die je mtl. € 300 Pflege [plus Pflegebudget € 724] in Anspruch nehmen, finanzieren mit € 1.000 1 Pflegekraft mit € 4.000 mtl. Diese 4 Leute, im Heim oder Senioren-WG, zahlen aus eigener Tasche als bombastische Eigenbeteiligung aktuell € 2.411. Ohne Gegenwert, denn der Heim- oder WG-Bewohner bekommt dafür keinen Brotkrumen extra oder einen Löffel bessere Pflegekost auf den Teller aufgetischt.
Umgekehrt gilt vielmehr: “Eine Frau, die ihre Pflege selbst in die Hand nimmt” (SD-Zeitung 01.04.2023) kann 3 Leute mit 1 Pflegebudget beschäftigen.
Finanzielle Eckdaten
Mitgliedsbeiträge: ...∅...€
Das favorisierte Servicemodell basiert auf einer Mikrovertragskonstellation. Das Pflegebudget entspricht für die Teilnehmer ein Mikromezzanine-Finanzierung. Wechselnde Versorgung wie Bettenwechsel bei Airbnb - realisiert als praxisnahes Mzodell eines Pflege-Hotels.
Spenden: ...∅...€
Öffentliche Zuschüsse: ...∅...€
Umsätze: ......€
On Demand werden Einnahmen in der Gig-Economy realisiert. Durch den Verkauf von sogenannten uno-actu-Handlungen bzw. instantane, intersubjektive pflegesensible Entitäten, generiert als Token, im pflegerischen Ereignisfeld, mittels transitive Pflege.
Konkret werden In Vorleistung erbrachte oder vorab schon gebuchte und online bezahlte Betreuungsleistungen mit ca. € 30,00 p.Std. in Rechnung gestellt; reine Pflegesachleistungen mit ca. € 60,00 p.Std. Ohne MwSt. gemäß § 4 UStG. Intrasituative Pflegesachleistungen können pro min abgerechnet werden, weil diese [verhandelbare] Leistungen sich trennscharf von reinen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (Facility) resp. Betreuungsleistungen gut abbilden lassen. Bei 80 Std. mtl. (entspricht TZ; 20 Std. Wö) sind € 2.400 br. für pflegesensible Betreuungspräsenz gut erzielbar. Bei Pflegepräsenz das doppelte: € 4.800 bei 20 St. Wö. Optional bei beiden Berufsprofile gilt als optimale Startposition ein TZ Angestelltenverhältnis im stationären Bereich empfehlenswert; sie vergünstigt die Ausgaben zu Lasten der SV.
Ausgaben
Aktive Akteure verbinden sich auf das vorhandenes Equipment (Angebotsfinder.nrw.de). Oder es wird auf Nachbarhilfe und informelle Pflege durch Angehörigen zurückgegriffen. Somit fallen keine Personalausgaben für die Durchführung der Initiative Quartierpflege an. Zulassungsgebühren für das Portal “Angebotsfinder.nrw.de” bei hybriden Auftritt : € 300,00; jhrl. Prüfungsgebühr ab € 10,00.
Personalkosten: .....∅…..€
Vergütung von Ehrenamtlichen: ...∅...€
Material- / Sachkosten: ± 6.400 € p.a.
Miete, Mietnebenkosten, IT- und Telefongrundgebühren, Versicherungen, KFZ und weitere Sachkosten wie Verbrauchsmaterialien, z.B. Druckerpapier, Printmaterialien, etc.
Finanzielle Situation
Einschätzung der aktuellen finanziellen Bedarfs der Initiative.
Die Initiative basiert auf den Strukturen einer Gig-Economy und ist finanziell unabhängig. Der Initiator bezieht Altersrente und startet das Projekt als Investor, der Sozialkapital gewinnbringend anlegen will.
Finanzielle Sonderthemen, die zu beachten sind
Marketingmaßnahmen sind aufgrund der lokal eingeschränkten Q-Präsenz bei der hier vorgestellten Konstellation Care mit Click & Brick zu vernachlässigen. Seitens der Q-Büros werden Beratungen aktuell kostenfrei erbracht; die Pflegekassen und die politische Gemeinde treten hier als Kostenträger auf. Zwei Problempunkte: (1) In dem Maße, wie Q-Büros sich nicht als moderne IPVZ bewähren und wg. chron. Leerlauf abgeschaltet werden (6.400 Beratungen p.a. in 6 Q-Büros, die z.T. jeweils mit 5 MA besetzt sind ergeben < 10 Beratungen tgl. / mithin ± 2 Kundenkontakte pro Tag pro MA) besteht dieser für Bürger “kostenlose” Service nur auf Papier. (2) Was nichts kostet, taugt i.d.R. auch nichts.
Beratungsservice in Q-Büros. Kostenfrei genutzte Präsenz-Beratung von Angestellte in Q-Büros weisen eine negative Gesamtbilanz auf. Es werden in Q-Büros Hasenpfaden gegangen, die von Zick nach Zack laufen um den bedarfspflichtige Bürger auf altbekannte Pfade einzusortieren.
Entlarvend: Es startete im Rahmen der Q-Büros 2022 innerhalb des gut strukturierten “Holding” des Q-Büro (pro-wohnen) eine je eigenen hauswirtschaftlichen Dienstleister (HUD). Diese wurde von Null auf 100 als einer der größten Anbieter auf dem Portal “Angebotsfinder.nrw.de” gelistet. Das bedeutet im Klartext: Präferenz von Versorgung durch zugelassene Anbieter [a] in der ambulante Pflege, [b] bei Projekte “Betreutes Wohnen” und [c] bei WG-Modelle (Senioren-WG; Demenz-WG).
Benchmarking Q-Pflege vs. WG & Heim als Wohnform Am 31. März 2023 wurde die WG als 30% Günstiger im Vergleich zum Heimplatz angepriesen - euphorisch von der Presse betitelt: “Große Freude über Platz im WG”. Diese Aussage ist finanzpolitisch sowohl richtig als auch falsch. Richtig ist die Angabe: Die WG bietet eine ⅓ preiswertere Unterkunft. Aber gleichzeitig ist der Fixpunkt dieser Aussage grundlegend falsch, weil wesentliche Kostenfaktoren aus der Kalkulation ausgeklammert blieben. Vernachlässigt in der Bilanz wurden 3 nicht eingepreiste Posten auf der Rechnung:
In einer WG müssen Pflegesachleistungen prinzipiell extra gezahlt werden, da der Anbieter kein Pflegepersonal für den Pflegebedarf beschäftigt bzw. vorhält (anders wie im Heim).
In WGs wird programmatisch nur Betreuung bei Senioren mit leichten mentalen Störungen und geringfügigen körperliche Einschränkungen angeboten; Menschen mit auffällige Symptome gehören zum “aussortierten Personenkreis”: Wer mit antriebsarme depressive Merkmale zu kämpfen hat und aggressive Verhaltensmuster zeigt und als suchtgefährdet gilt, findet kein WG-Platz (anders wie bei begehrter Heimbezug oder Heimeinweisung).
Nicht nur der Pflegeaufwand wird als Extraposten verrechnet: auch alle anderen Hotellerie-, Facility- und Unterkunftskosten, nebst Heiz- und Energiekosten, Internet etc. sind nicht gedeckelte Kosten (anders wie im Heim). Am Ende zahlt der WG-Nutzer die Zeche - anders als im Heim, wo der Anbieter (z.B. wg. Mißmanagement) auf die Kosten sitzen bleibt, die ihm die Kostenträger (Pflegeversicherung etc.) nicht erstatten.
Fazit: Kostenfalle Senioren-WG, bei der der wirklich pflegebedürftige WG-Bewohner nur die Flucht im Heim übrig bleibt. Bei prekäre Ausgangslagen ist Heimversorgung vielfach ein non-plus-ultra. Oder: Der Nutzer arrangiert seinen Pflegebedarf daheim - bei identischen Pflegesachleistungen, jedoch ohne Hotelleriekosten und sogenannte Investitionskosten zusätzlich tragen zu müssen.
6. Ausblick und Beratungsbedarf
Wo die Initiative in 2 bis 3 Jahren stehen wird
Das TSVG als Triggerpunkt: In 2 wie in 3 Jahren wird es der Initiative gelingen, die temporäre Heimversorgung eines “H@H” Pilotprojekt zu realisieren. Von der Gesetzgeber i.V.m. § 71 (1a) SGB XI als Option geschaffen, um pflegesensible Pflegepräsenz auszulagern. Zwecks teure stationäre Klinik zu übertragen in den Händen versierte, nach dem PflBG n. § 124 SGB V zugelassene, betreuende Pflegeprofis. Die Initiative wird nach anerkannten Standard der Pflegeforschung evidenziterative Service-Leistungen (home-care) im häuslichen Bereich mit optimale Lösungen versorgen. Die seit 2020 vor Ort gegenüber hybride Aufstellung verfochtene Verbotskultur und Silomentalität wird in 2 - 3 Jahren endgültig Geschichte sein.
Marketing & Recruitment. Bedarfspflichtige Bürger werden vermehrt in 2-3 Jhr. ihr Zuhause als ambulante Mikro-Raum, at bedside erleben als behaglichere Komfortzone. Optional Im Vergleich mit ein Pflegezimmer im Heim mit notorische Größe zw. 16 - 25 qm.
Oberhausen wird in 2-3 Jahren zu Pflegehausen. Wenn 3 Faktoren erfüllt werden:
Pflegetickets n. § 35a SGB XI werden ohne Konditionierungszwang ausgestellt
Die für Nutzer eines Pflegebudget aufgesattelte Initiative wird angenommen
Pflegeprofis wandern aus Heim und Klinik ab um lieber € 4.800 bei 20 Std./Wö. bei Budgetnutzer zu verdienen statt € 2.400 im Heim bei 40 Std./Wö. zu malochen.
Digitale Präsenz. Überlegenswert: als Initiative mit NPO-Präsenz in 2-3 Jhr. eine eigene APP (z.B. “Pflegefinder4OB”) entwickeln; u.U. wertvoll im Zuge einer Nationale Demenzstrategie. Dann, wenn es amtliche Auskünfte nur verzwickt gibt. Oder man aus anderen Gründen die autonom aufgestellten, modernen Sozialfigur des pflegerischen Subjekts ausblendet. Oder Q-Büros mutieren zu Gatekeeper der Interessenverbände. (“Stellen-Selbsterhalt”). Oder wenn kommunale Q-Büros als PVZ umstrukturiert, reduziert und eingestellt werden:
Um die Selbstorganisation der Pflege durch den Budgetnutzer zu fördern, kann es empfehlenswert sein, via einem Portal in der Art “Airbnb” auf bereits verfügbare APP-Entwicklungen zurückzugreifen, um pflegesensiblen Service besser zu kartieren.
Um das Quantum an betreuende Pflegepräsenz geschickt zu erhöhen kann das Einzugsgebiet OB-Zentrum erweitert werden, indem Nutzer auch auf selbständiger Betreuungskompetenz aus DU, Essen, BOT, MH zugreifen zu können. Was im aktuellen Portal “Angebotsfinder.nrw.de” auch aktuell der Fall, bei der Leistungsträger mit Q-Service im Angebot auch Städteübergreifend platziert sind.
Die aktuelle Herausforderungen 2023:
Öffentlichkeitsarbeit. Gig-Economy- Freelancer sind Auftrittsmenschen. Akteure einer Pflegepräsenz, die im Zuge der Initiative für Quartierpflege eine demokratische, autopoietisch strukturierte, kulturelle Leistung erbringen. Sich selbst und sein Berufsprofil angemessen fortzubilden und öffentlichkeitswirksam weiter zu entwickeln gehört zur profizienten Erscheinungsbild dazu. Nach Frank Kegelmann fordert die Gesundheitskonferenz der Stadt Oberhausen, Bereich 3-2 / Soziales i.V.m der Örtliche Planung gem. § 7 APG NRW auf S. 80 “ein ganzheitliches Pflegeverständnis ein, in dem im engeren Sinne pflegefachliche Verantwortungsbereiche und das Gelingen ganzheitlicher (gesundheitlicher) Versorgung unter einem umfassenden Pflegebegriff (the Core of Cure is Care) zusammengefasst werden.”
Wirkmächtige Domänenwissen bleibt ohne Selbstarbeit und Selbstmanagement der Akteure zukunftsferne Utopie, zwecks Verbesserung eines komplementäres Q-Pflege im Sinne des TSVG um pflegesensible Daseinsversorgung optimal zu terminieren und zu organisieren.
Weiterbildungsleistungen und erweiternde Wohnkonzepte, umgesetzt, erhalten von Behörden und von politisch und gesellschaftlich wirksamen Institutionen Gegenwind.
Doofpot Kultur. Exemplarisch verleugnen 2023 zwei Teilnehmer der Stadt Oberhausen ihre Teilnahme am 4. Sozialkonferenz Ruhr am 31. Mai 2022 oder können sich (als Koordinatorin alle sechs Q-Büros in Oberhausen) an deren Teilnahmen nicht mehr erinnern - geschweige deren Inhalte. Dabei sind diese Personen, Fr. Stefanie L. und Fr. Nese Ö. engagierte Bürger in Amt und Würden, die nicht nur im Demenznetzwerk der Stadt Oberhausen mit Beiträge und vielfach ausgezeichnetes Engagement sehr präsent sind.
Erscheinungsbild. Wie nimmt der Bürger selbständig betreuende Pflegeprofis wahr? Es genügt nicht, nur die Anforderung an evidenziterative, pflegesensible Betreuungsprozesse nach den Vorgaben des § 71 (1a) SGB XI zu genügen mit dem Ziel i.S. des PflBG, einwandfrei Vorbehaltsaufgaben erbringen zu können. Um im Wesentlichen das holistische Berufsprofil in der gesellschaftliche Wahrnehmung zu schärfen, sind Pflegesensible Fortbildungen bei zertifizierte und nach dem RbP akkreditierte Institutionen eine conditio sine qua non. Aktuell beäugen die zuständige, hiesigen Behörden hybride Aufstellungsmerkmale mit ein gewisser Argsinn, was an sich gut ist: denn De:Professionalisierung einer pflegesensible Betreuung durch berufsfremde Handlanger verhindert echte Weiterentwicklung eines vom Bürger autonom geregelte pflegesensible Versorgung. Pflege wird um keinen Millimeter vorwärts gebracht durch fragwürdige Pflegeportale wie “Pflegix,” Ebay-Kleinanzeigen, Helpling und Co. Diese Portale vermitteln kostenlos; allenfalls wird ein billigen Gewerbeschein (zw. € 10 - € 65) verlangt. Die eingesparte Zulassungsgebühren in der Startphase von € 300,00 (bei hybride Aufstellungsmerkmale) plus Schulungen und weitere Gebühren (PFZ) und komplette, zertifizierte Basisqualifikation n. AnFöVO für € 359,00) verhindert, dass Service, vermittelt durch Agenturen wie Pflegix & Co, im günstigsten Fall, nur bedingt als Budgetfähig gilt.
Argumentationsfreie Verwerfungskriterien mit dem Prädikat “Nicht zielführend” werden von Behörden seit Jahren ins Spiel gebracht bei hybride aufgestellte Pflegepräsenz. Diese gilt es 2023 normkonform zu überwinden und darzulegen, dass es den Bürger nützt, vorbehaltlos eine hybride aufgestelltes Leistungsprofil i.V.m. § 35a SGB XI im Rahmen der TSVG-Kriterien in Anspruch nehmen zu können.
Das sollte eigentlich mit der Zulassung 2021 geklärt sein, stellt sich jedoch als Bremsklotz im Wege im Zuge der von den Behörden ausgelegten gesetzlichen Vorgaben. Unbestritten ist, dass Pflegeprofis verpflichtet sind, jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen mit Angaben zu FB-Maßnahmen - und somit das Recht der Behörde, Wertungen vornehmen zu dürfen.
Nachgefragte Auskünfte, was i.V.m. § 71 (1a) SGB XI mit dem als “Killerphrase” geeignetes Prädikat “Nicht Zielführend” (Es ist wie es ist, weil es so ist wie es ist) gemeint, und was als FB bei hybride Auftritt Zielführend sei, blieben bisher bei den zuständigen Behörden und involvierten Regionalbüros (Fr. Becker, 16.03.2023) ohne Antwort. Hier sind 2023 ff. noch vorhandene Ressentiments und unnötige Spannungsfelder zu schlichten, zu Gunsten einer auf fundierte Unterstützung und kongruente Zuwendung angewiesene Teil der Bürgerschaft.
“Gemeinsinn stärken” - das konkrete Themen, das die Initiative stärken will.
Die Initiative positioniert sich nicht als Solitär. Aktuell zeigt ein Leipziger Projekt zu Q-Pflege “Gemeinsinn stärken” ebenfalls gangbare Pfade auf, die in die gleiche Richtung zielen. Zentral steht immer die komplementäre Verknüpfung pflegesensibler Betreuung mit verbindenden Overlay-Kapazitäten. Das Leipziger Modell ist fokussiert auf eher informelle Pflege im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe (im weitesten Sinn). Bei dem hiesigen Q-Projekt steht das Pflegebudget.de (2044 - 2008) Pate. Mehrfach besuchte der Initiator deren Symposien in Düsseldorf und Berlin. Das Modell wurde u.A. fortentwickelt und realisiert im Walzbachtaler Projekt mit ambulanter Rundum-die-Uhr-Betreuung.
Bereichen bei der Unterstützung und Entwicklungsbedarf gebraucht werden:
Projektmanagement
IT / Internet
Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit
Gewinnung / Management von Mitwirkenden
Versicherungen / Rechtliches; besonders:
[Geltungssphäre v. § 71 (1a) SGB XI - TSVG].
7. Formale Angaben
mmw.med-ipflege, Sanderstr. 15
in 46045 Oberhausen.
Marten Wiersma,
Sanderstr. 15
46045 Oberhausen.
Organisationsform und -stand
Gründungsjahr: 2007
Organisationsform: Zulassung gem. § 124 SGB V
Institutionsnummer: 462516768
Steuernummer: 124/5127/2176
Gemeinnützigkeit anerkannt: Nein
Träger (keine vorhanden):
Singuläre, selbständiger Auftritt [Gig-Economy]
ohne Trägerorganisation.